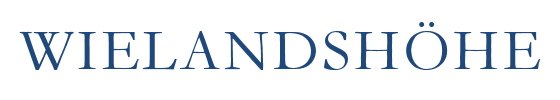Liebe Laura,
heute haben wir den 6. August und vor drei Tagen am Sonntag hatte ich einem interessierten Pfullinger Publikum aus meinem Schwaben Buch erzählt und unter anderem, den Ort des Sprechgitters als einen meiner drei Kraft Orte bezeichnet. Da wäre als erstes das Schweizer Kloster Müstair in der Nähe des Reschenpasses, die Insel Torcello bei Venedig, selbstverständlich die Wielandshöhe und der Kirchgarten in Pfullingen.
Sonntagnachmittag im Jahr 2014, also vor mehr als zehn Jahren fahre ich nach Pfullingen, einer Stadt am Rande der schwäbischen Alb. Ob hier Menschen leben? Der Ort brütet in der Sommerhitze wie ausgestorben vor sich hin. Wie so oft bei kleinen und auch großen Städten muss man sich durch äußeren Bollwerke merkantiler Hässlichkeit kämpfen, um dann, fast verzweifelt, kurz vor der Kapitulation und der Umkehr, dann doch noch ein wenig verwundert, das Schöne zu finden.
In der Nähe des Klostergartens sind die Verunstaltungen der zurückgelassenen Investorenarchitektur schnell vergessen. Im Garten selbst, gleich vor dem Sprechgitter und den Resten des gotischen Klosters, sitzt eine Dame und liest einem bunten Häuflein Literaturinteressierter mit lauter Stimme vor. Ich mache von dem symbolkräftigen Ort ein Pflichtfoto und schleiche mich mit meiner Frau ums Eck. Hier darf nicht gestört werden. Diese Maxime atmet der Ort seit achthundert Jahren aus. Ich grüße die hochaufragende Kirche, die fast an einen Wehrturm erinnern- „Wir kommen wieder!“ So kam es auch und zwar öfters. Keine Fahrt auf die Schwäbische Alb, an der Burg Lichtenstein vorbei, ohne einen kurzen Haken zu schlagen und im Klostergarten kurz zu rasten.
Wie doch die verflossene Zeit so manches in ein verklärtes Licht rückt, wie wir uns das Vergangene schön ausmalen! Damals, im 13. Jahrhundert, wurde den Nonnen unter den strengen Regeln der Klara von Assisi einiges abverlangt. Die Klarissinnen schliefen auf einem Strohsack, allenfalls durch eine Wolldecke geschützt. Beim Eintritt in das Kloster wurden ihnen die Haare abgeschnitten. Eine weiße Haube, die bis zu den Schultern reichte, verdeckte die Verunstaltung. Die Kutte, durch einen Strick gerafft, berührte fast den Boden. Am vierten und sechsten Tag der Woche blieb die Küche kalt, rohe Äpfel und Birnen mussten den Schwestern reichen. In der Fastenzeit war es dann völlig zappenduster, und man darf annehmen, dass alle Nonnen unter Mangelerscheinungen litten. Leute wie ich, also ein Koch, wurden nicht benötigt, allenfalls gab es einen Beichtvater, der nach Ausübung seines Amtes schleunigst wieder zu verschwinden hatte. Es war eine besondere Form von Folter mit dem Versprechen, dass im Himmel später dann alles zu Glück verklären würde. Welch ein Wahnsinn: Man ging mit dem Einbruch der Dunkelheit zu Bett, um kurz nach Mitternacht zum Beten aus dem Schlaf gerissen zu werden. Danach warf sich die Klosterschwester noch einmal aufs harte Strohlager, um gegen halb drei Uhr wiederum in der Klosterkirche in die Knie zu gehen. Nach solcherlei Salbungen der Seele schlurfte sie wiederum zurück aufs zusammengehockte Stroh um dann gegen vier Uhr morgens alles noch einmal zu wiederholen. Man schritt barfuß, selbst im Winter bei Glatteis, und die Lebenserwartung, wen wundert’s, betrug trotz der Fürsorge des Allmächtigen nur etwa achtundzwanzig Jahre. Frauen, die in das Pfullinger Kloster eintraten, hatten nahezu keine Chance mehr ihre Entscheidung und ihr Leben zu ändern. Selbst die letzte Reise auf den Friedhof war festgelegt. Jede Insassin bekam innerhalb der Klostermauern ihren Parkplatz, von dem aus die Seele in den Himmel zu entschwinden hatte. Man glaube ja nicht, dass die Novizinnen ausnahmslos freiwillig solch ein Leben wählten. Ich wusste durch die Tätigkeit meines Vaters als Tierarzt, dass Mädchen auf dem Bauernhof häufig unerwünscht, und nur allzu oft in Klöster abgeschoben wurdenAnsammlungen von mehreren Frauen sollen ja angeblich ein Quell des Quasselns sein, und vielleicht hatte sich die Ordensgründerin deshalb noch etwas Spezielles ausgedacht: Innerhalb des Klosters galt bis auf Ausnahmen, absolutes Sprechverbot. Und nun kommen wir, bevor uns dieses Thema nach Paris entführt, zum berühmten Sprechgitter, das – einmalig in Europa – in Pfullingen noch erhalten ist. Die Ordensregel dieses Schweigeklosters sah zwei Redefenster vor. Eines befand sich in der Kirche und hatte ein kleines Türchen, durch das der Priester den Schwestern die Oblate der Eucharistie auf die Zunge zu legen hatte. Ein zweites Gitter sorgte für die Verbindung zur Außenwelt. Da von dem Kloster nicht mehr viel übrig ist, steht das gotische Sprechgitter nun isoliert im Feien, sozusagen als solitäres Fragment und als Mahnmal für alle Leute mit Redezwang. Dieses zweite Sprechgitter lag ursprünglich an der Außenmauer des Klosters. Eigentlich ist es kein Gitter, sondern eher eine grob geschmiedete Eisenplatte mit Lö-chern, letztlich ein Lochblech. Es ist so gefertigt, dass man nur miteinander reden, sich aber nicht sehen konnte.
Ich wandle mit meiner Frau durch das Grün, mittlerweile eine Idylle, die mich jedesmal zum Schweigen und Nachdenken zwingt. Einen Steinwurf vom Sprechgitter flirrt durch sonnenbesprenkelte Eichenblätter die Fassade eines mächtigen Hauses, welches die Hinterlassenschaft eines gewissen Günther Neske und seiner Frau Brigitte beherbergt. Hier befand sich bis 1993 der Neske Verlag, die geistige Heimat von Leuten wie Martin Heidegger, Ernst Bloch, Walter Jens, Ernst und Gretha Jünger und so weiter. Der Verleger konnte auf seine Lebensleistung und die Riege seiner Autoren stolz sein. Einen Autor jedoch hatte er nicht einfangen können: Paul Celan.
In etwas mehr als einem Monat, also Ende September werde ich mit Eva nach Paris reisen. Wir werden uns sicherlich dem intellektuellen Bodennebel der Stadt Paris annähern, den ich bereits in meinem Parisbuch beschrieben habe. Trotz Paris, ist das Brennglaus noch hellbrennend auf Pfullingen und das Sprechgitter gerichtet. Davon gibt es bis heute eine Schwarz-Weiß-Postkarte. Günther Neske hatte sie mit dem Expedierdatum 3. Juni 1957 beigegeben. Der Brief galt dem Dichter Paul Celan, der in Paris lebte und den Neske für seinen Verlag gewinnen wollte. Eine Antwort erfolgte alsbald, und es kam zu einem wohlwollenden Hin und Her. Letztendlich wollte sich Celan, wahrscheinlich aus Gründen einer besseren Verbreitung seiner Bücher und seines Rufs, lieber dem großen S. Fischer Verlag anvertrauen. Die Postkarte mit dem Sprechgitter jedoch blieb dem Dichter fest im Kopf, um diesem wenig später als Gedicht von Weltrang wieder zu entweichen.
SPRACHGITTER
Augenrund zwischen den Stäben.
Flimmertier Lid
rudert nach oben,
gibt einen Blick frei.
Iris, Schwimmerin, traumlos und trüb:
der Himmel, herzgrau, muss nah sein.
Schräg, in der eisernen Tülle,
der blakende Span.
Am Lichtsinn
errätst du die Seele.
(Wär ich wie du. Wärst du wie ich.
Standen wir nicht
unter einem Passat?
Wir sind Fremde.)
Die Fliesen. Darauf,
dicht beieinander, die beiden
herzgrauen Lachen:zwei
Mundvoll Schweigen.
Die Gedichte Celans kann man nicht so einfach in sich hinein lesen, man muss sie sich erarbeiten. «Zwangsjackenschön» nannte er selbst die Liebe, die man ihnen angedeihen lassen solle.
1920 in Czernowitz geboren, wurde Celan als junger Jude in die Welt der Nazis geworfen. Mutter und Vater starben im Lager. Celan bewegte sich innerhalb der Kulturen der untergegangenen Donaumonarchie, Deutschlands und Frankreichs und zwischen allen Stühlen einer grausamen Zeit. Als er dieses Gedicht schrieb, lag das Ende des Zweiten Weltkriegs noch nicht lange zurück. Er sah und spürte noch die Verwundungen, welche die Stadt Paris durch die Deutschen hatte erleiden müssen. Er sah und erlebte noch das kriegsgeschundene Paris, welches ein Schiff im Stadtwappen führt, ein Segler, der schwankend durch die Zeiten schlingert, aber aufgrund seiner inneren Kraft nicht untergeht.
AUF HOHER SEE
Paris, das Schifflein. Liegt im Glas vor Anker:
So halt ich mit dir Tafel, trink dir zu.
Ich trink so lange, bis Paris in seiner Träne schwimmt,
so lange, bis es Kurs nimmt auf den fernen Schleier,
der uns die Welt verhüllt, wo jedes Du ein Ast ist,
an dem ich hänge als ein Blatt, das schweigt und schwebt.
Schaut man auf den Stadtplan, so kann man die beiden Inseln in der Seine durchaus als ankernde Schiffe und als allegorisches Bild deuten. Da wäre vom Louvre aus gesehen zuerst die Île de la Cité, auf der die Kathedrale Notre-Dame in den Himmel ragt. Über eine schmale Brücke geht es weiter flußaufwärts auf die Île de Saint-Louis. Rechts fällt mein Blick auf die Brücke, die zum Quai de la Tournelle führt.
An der Ecke grüßt das Café L’Escale. Ich drücke mir die Nase an der großen Schaufensterscheibe platt. Das Interieur ist seit den fünfziger Jahren unverändert: beige-brauner Mosaikboden, Tresen in der Mitte, Lampen, die die Himmelsrichtungen anzeigen. Celans Augenmerk galt aber seinerzeit nicht dem Interieur, sondern seiner Geliebten Brigitta Eisenreich, die er an diesem Ort traf. «L’ Escale» ist nicht leicht ins Deutsche zu übersetzen, es bedeutet so et-was wie «Zwischenhafen», in dem ein Schiff auf einer langen Reise haltmachen kann. Auf einer Tafel werden «Boeuf Bourguignon» und Würste aus Montbéliard angeboten. Schmatz! Ich kämpfe mit der Selbstbeherrschung, denn ich habe bereits woanders reserviert. Das «L’ Escale» ist offensichtlich ein ungewöhnliches Café, das sich nicht nur seiner kleinen Fleischgerichte, sondern auch außergewöhnlicher Kuchen rühmt. Das Etablissement dient in gewisser Hinsicht als Versorgungsstation für Einheimische, die hier auf der Insel wohnen. George Moustaki verkehrte hier oft. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie da sitzen, vor dreiundsechzig Jahren, Paul Celan und Brigitta Eisenreich. Wie sie miteinander reden und in zaghafter Annäherung die Hände ineinanderlegen. Ich sehe sie ganz klar vor mir. Beide verlassen das Lokal. Ich meine zu beobachten, wie der Dichter zum Himmel blickt, dessen Farbe er mit «herbst-zeitlos» weiht. Sie gehen umschlungen zur Brücke, die sich hinüber zum anderen Flussufer spannt. Er deutet auf das dunkle Wasser, und das Liebespaar steigt die Treppe hinab zum Kai. Schwere Ringe sind in die Quader der Uferbefestigung eingelassen. Celan hebt sie an, und beide lauschen auf den Klang, als eisenschwer der Ring an den Stein knallt.
Ich stehe nun mitten auf der Brücke und bin ganz wirr im Kopf. Wache ich oder träume ich? Vor einiger Zeit habe ich das Buch «Celans Kreidestern» gelesen. So erfuhr ich von Brigitta Eisenreich, die neun Jahre lang seine Geliebte war. Aus seiner Traurigkeit konnte sie ihm ebensowenig helfen wie seine Frau Gisèle de Lestrange .Bis in unsere Tage lässt sich bei Dichtern und vielen Männern, die von der Öffentlichkeit beäugt werden, ein ausgeprägter Narzissmus diagnostizieren. Celan bildete da keine Ausnahme, verdient jedoch mildernde Umstände. Er war liebesstark und höchst sensibel, Letzteres vorwiegend zu sich selbst. Der Dichter musste aber auch durch schwere Prüfungen gehen. Von der Nazizeit will ich hier gar nicht reden, sondern mehr von den Nachbeben dieses größten Unglücks aller Zeiten. Fischt man in den schwarzen Wassern der fünfziger Jahre, muss die Gruppe 47 genannt wer-den. 1952 labte sich dieses selbsternannte Dichtertribunal an Celan mit Verunglimpfung, als der seine später berühmt gewordene «Todesfuge» vortrug. Ignorant und überheblich, verstanden die anwesenden Kollegen die Größe seiner Dichtkunst nicht, und mit dem leicht ostjüdischen Sing-sang seiner Vortragsweise kamen sie erst recht nicht zu Rande. Früher flüchteten sich Diskutanten, denen nichts mehr einfiel, in ein Lied. Die ganz offensichtlich verunsicherten Herren Dichter, darunter Hans Werner Richter, Siegfried Lenz und Walter Jens, retteten sich ins Gelächter. Verstört schrieb die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann danach in ihr Tagebuch: «Am zweiten Abend wollte ich abreisen, weil ein Gespräch, dessen Voraussetzungen ich nicht kannte, mich plötzlich denken ließ, ich sei unter deutsche Nazis gefallen (…) Am zweiten Tag wollte ich abreisen, am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor, vor Aufregung am Ersticken…» Hier sollte nicht ver-schwiegen werden, dass Ingeborg Bachmann und Paul Celan jahrelang eine dramatische Liebesbeziehung pflegten.
Ich gehe nun vollends auf die Brücke und schaue den Fluss hinab, an Notre-Dame vorbei inRichtung Eiffelturm, dort biegt sich eine sehr schöne Brücke über den Fluss. Es ist die schon erwähnte Bir-Hakeim. Ein Stück weiter folgt die Pont Mirabeau. Vermutlich hat sich Paul Celan am 20. April 1970 von dieser Brücke in die Seine gestürzt. Nicht weit entfernt, in der Avenue Émile Zola, hatte er zuletzt gewohnt. Die Umstände und das genaue Datum seines Todes sind allerdings nicht geklärt. Sein Leichnam wurde am 1. Mai 1970 bei Courbevoie, zehn Kilometer flussabwärts von Paris, aus dem Fluss geborgen. Am 12. Mai 1970 wurde Paul Celan südlich von Paris auf dem Cimetière Parisien de Thiais beigesetzt.
Ich wende mich ab, um auf andere Gedanken zu kommen. Auf der anderen Straßenseite, dem Quai de la Tournelle Nr. 15, sehe ich das Restaurant «Tour d’Argent». Über dieses hochelegante Lokal habe ich schon öfters geschrieben, 1974 war ich das erste Mal mit meiner Frau dort, um die berühmte Ente zu essen. Das Tier wurde am Tisch tranchiert und seine Gebeine in eine silberne Spindelpresse hineingedrückt. Dann wurde gekurbelt und gepresst und aus dem herausströmenden Saft und das Mark die Sauce zur Köstlichkeit angehoben. Dazu einen Bordeaux „Chateau Branire Ducru, den Rest liebe Laura kannst du Dir denken…