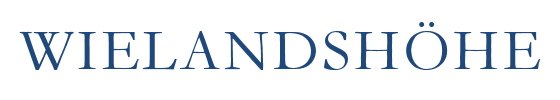Liebe Laura,
von einem wackeren Schwaben will ich Dir berichten, von Matthias Erzberger. Er war Finanzminister in der Weimarer Republik und stammte aus dem idyllischem Lautertal, das sich unterhalb von Münsingen bis zur Donau hinzieht. Mein Lieblingsort in diesem Wanderparadies ist Buttenhausen. Von dort, von der Lutzmühle beziehen wir unser Mehl zum Brotbacken. Buttenhausen ist nicht nur deswegen etwas Besonderes. Matthias Erzberger wurde dort geboren. Auch Gustav Landauer kommt von dort, einer der treibenden Revolutionäre der Münchner Räterepublik. Mit Erzberger hat er gemein, dass auch er erschossen wurde. Der Flugvisionär Gustav Mesmer, ein genial-verrückter Kerl, verbrachte sein Leben in dem Fünfhundertseelendorf Buttenhausen, und das weltberühmte Kunsthandelshaus Bernheimer hat dort seine Wurzeln.
 Der jüdische Friedhof in Buttenhausen
Der jüdische Friedhof in Buttenhausen
Die Bernheimers zogen 1864 nach München und bauten das riesige Palais Bernheimer am Münchener Stachus. Konrad Otto Bernheimer (*1950) hatte das Unternehmen 1977 vom Vater übernommen und richtete das Haus ganz auf den Handel mit Alten Meistern aus. 1987 verkaufte er das große Bernheimerpalais an den Immobilienjongleur Jürgen Schneider für ungefähr hundert Millionen DM. 2002 erwarb Bernheimer die traditionsreiche Londoner Galerie Colnaghi (gegründet 1760), die als eine der ältesten Kunstgalerien gilt. 2016 gab Bernheimer den Standort München auf und fokussierte sich insbesondere auf London. 2015 veräußerte Colnaghi an die spanischen Kunsthändler Jorge Coll und Nicolás Cortés. Soviel vorweg und nun ab in die Champagne.
DIE REISE IN DEN WALD
Durch die Champagne zuckeln wir und hatten einiges hinter uns und noch viel vor uns, dafür sorgte Eva mit erstaunlichem Weinwissen. Sie will sich trotzdem nicht Sommelière nennen, da ist ihr zu viel Gedöhns unterwegs. Sie, als Herrin über 500 verschiedene Weine im Keller und einem monatlichen Einkauf von fünfzehntausend Euro, muss einem strengen Pragmatismus folgen. Da bleibt für Weingeschwafel und Liebhaberpoetik keine Zeit.
Spontan, nach dem Besuch des berühmten Champagnerhauses Bollinger und der Freude, dass der Gründer Jacques Bollinger aus Ellwangen stammt, kam uns beiden stolzen Schwaben die Idee, dass eine Champagnerexpedition auch aufs Hirn schlagen könnte.
Etwas erkältet schnaufte mich Eva an: “Wir sind ganz in der Nähe von dem Eisenbahnwaggon, der im ersten und zweiten Weltkrieg zur Ikone wurde!” So kam es zu einem kleinen Umweg nach Compiègne. Im Hundertjährigen Krieg spielte der Ort bereits eine Rolle und bis heute ist er ein größeres Dorf. Am Rande eines riesigen Waldes war es mehrfach umkämpft. Berühmt ist die Gefangennahme von Jeanne d’Arc (Johanna von Orléans) 1430 bei Compiègne.
Mitten im berühmten Wald von Compiègne ist die Villa des General Foch zu finden. Ich weiß nicht, ob man diese besichtigen kann, denn Eva und ich interessierten uns für den Waggon, in dem die Friedensverhandlungen des Ersten Weltkriegs vollzogen wurden. Auf deutscher Seite war der Staatssekretär Matthias Erzberger aus Buttenhausen federführend. Auf französischer Seite leitete Marschall Ferdinand Foch (1851 – 1929) die Waffenstillstandsverhandlungen.
 Das Museum in dem der Waggon ausgestellt ist.
Das Museum in dem der Waggon ausgestellt ist.
Am 11. November 1918 unterzeichneten die deutschen Unterhändler die Bedingungen in Fochs Eisenbahnwaggon. Foch war dabei streng, aber nicht triumphierend. Er sah den Waffenstillstand als Notwendigkeit, um den Krieg zu beenden. 1919 wurde er zum Marschall von Frankreich ernannt – die höchste militärische Auszeichnung. Er erhielt ein Staatsbegräbnis und wurde im Invalidendom nahe bei Napoléon Bonaparte beigesetzt. In Frankreich gilt er bis heute als einer der größten Feldherren des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Straßen, Plätze und Denkmäler tragen seinen Namen. Kurz gesagt: Foch war der militärische Architekt des Sieges von 1918 – eine Mischung aus Strategie, Kämpfer und Symbolfigur des französischen Widerstands.
Aus der Zeit des Ersten Weltkriegs hat Deutschland auch einen Volkshelden. Kommen wir zu den Verdiensten des Schwaben aus Buttenhausen. Es gibt Stimmen die sagen, das Bekannteste an dem damaligen Staatssekretär Matthias Erzberger sei die Tatsache, dass er erschossen wurde, das allein reiche jedoch nicht zu wirklicher Verehrung.
Das weise ich entschieden von mir, und auch die Wissenschaft sieht das so. Man kann dem Schwaben nicht am Zeug flicken. Matthias Erzberger war Mitglied der Zentrumspartei und ab 1903 Reichstagsabgeordneter und trat für eine gerechtere Verteilung der Lasten zwischen dem Deutschen Reich und Bundesstaaten. Während des Ersten Weltkriegs entwickelte er sich vom anfänglichen Kriegsbefürworter zum Befürworter eines Verständigungsfriedens. Erzberger war treibende Kraft hinter der Friedensresolution des Reichstags im Juli 1917. Sie forderte ein Ende des Krieges „ohne Annexionen und Kontributionen“. Damit war er einer der ersten führenden Reichstagsabgeordneten, die offen einen Ausweg aus dem Krieg suchten.
 Frankreich und Deutschland sitzen sich gegenüber.
Frankreich und Deutschland sitzen sich gegenüber.
Mit dem Frieden im Eisenbahnwaggon tat er dies in der Überzeugung, Schlimmeres von Deutschland abwenden zu müssen. Für die Nationalisten wurde er dadurch zur Symbolfigur der berüchtigten „Dolchstoßlegende“ und als „Novemberverbrecher“ diffamiert. Dieses Lügenkonstrukt diente als Propagandainstrument, um die Verantwortung für die Kriegsniederlage von den militärischen Eliten auf die zivile Politik und auf die demokratischen Kräfte abzuwälzen. Es waren vornehmlich bornierte Adelige, Betonkopftypen, die einfach nicht einsehen wollten, dass Deutschland komplett im Eimer war. Vielleicht waren sie auch so abgehoben, dass sie gar nicht wussten, wie das deutsche Volk gegen den Hunger und die Zerstörungen ankämpfte. Die Dolchstoßlegende schwächte die Legitimität der jungen Weimarer Republik, befeuerte den Antisemitismus, den Hass auf Sozialisten und Kommunisten und wurde später massiv von den Nationalsozialisten genutzt.
Als Reichsfinanzminister der Weimarer Republik (1919–1920) setzte Matthias Erzberger eine umfassende Reform des deutschen Steuersystems durch. Er sorgte für einheitlicher Reichssteuern (z. B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) und für die Stärkung der finanziellen Eigenständigkeit des Reichs gegenüber den Ländern. Große Verdienste hatte er mit dem Aufbau einer modernen Finanzverwaltung durch Reichsfinanzämter.
Diese Reformen bildeten die Grundlage für die finanzielle Handlungsfähigkeit. Sie gingen jedoch auch zu Lasten des Besitzbürgertums und auch der Industrie und deren Fähnchen flattert immer dort, wo der Umsatz bläst. Nach seiner Zeit als Finanzminister, in der er u.a. die Reichsfinanzreform durchsetzte, zog er sich aufgrund massiver Hetze und Verleumdungen 1920 aus der Regierung zurück. Doch er blieb eine Symbolfigur für Demokraten wie auch ein Hassobjekt für Rechtsradikale.
Am 26. August 1921 wurde der ehemalige Reichsfinanzminister Matthias Erzberger im Schwarzwald bei Bad Griesbach (heute Ortsteil von Baiersbronn) ermordet. Erzberger spazierte mit seinem Parteifreund und Bekannten Carl Diez durchs Grün in Bad Griesbach. Zwei Mitglieder der rechtsterroristischen Organisation Consul (einer Nachfolgeorganisation der Freikorps-Einheit „Marinebrigade Ehrhardt“), Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz, lauerten ihm dort auf. Sie gaben mehrere Schüsse ab, von denen Erzberger tödlich getroffen wurde. Carl Diez wurde schwer verletzt, überlebte jedoch. Der Mord erschütterte die Öffentlichkeit. Erzberger war zwar in konservativen und rechten Kreisen verhasst, aber als Architekt der Finanzreform und Symbolfigur des demokratischen Staates aber auch geachtet. Linke und demokratische Politiker wurden damals regelmäßig Opfer von Gewalt, während rechte Täter meist milde Urteile oder gar Straffreiheit erhielten.
Erzbergers Tod war ein Signal: Die extreme Rechte war nun bereit, politische Gegner durch Terror auszuschalten. Dieses Klima führte ein Jahr später 1922 zum noch spektakuläreren Mord an Außenminister Walther Rathenau. Beide Attentate schwächten die Weimarer Demokratie, da sie die tiefe Spaltung im Land und die fehlende Abwehrkraft des Staates gegenüber rechter Gewalt offenlegten. Diese Morde waren Teil einer ganzen Serie politischer Attentate in der Weimarer Republik – man sprach bald vom „Fememord“.
Matthias Erzbergers Grab befindet sich in Biberach an der Riß, seiner Heimatstadt in Oberschwaben.
Kurt Tucholskys Nachruf auf Erzberger nach dessen Ermordung am 26. August 1921 im Schwarzwald, in der Nähe von Bad Griesbach (Baden):
Gehaßt, weil du Konkursverwalter
der Pleitefirma Deutsches Reich,
liegst du zerschossen als ein kalter
und toter Mann – und Deutschland ist das gleich.
Es kostet nichts. In Blutkapiteln
erlebten wirs – was kriegt solch Vieh?
Den Auslandspaß – ›Nichts zu ermitteln‹:
so kämpft der Geist der Monarchie.
Gehaßt, weil du Zivilcourage den Herren vom Monokel zeigst
weil du schon Siebzehn die Blamage
der Ludendörffer nicht verschweigst …
Das kann der Deutsche nicht vertragen:
dass einer ihm die Wahrheit sagt,
dass einer ohne Leutnantskragen
den Landsknechtgeist von dannen jagt.
So fielst du.
Hinter deiner Bahre
gehn grinsend, die den Mord gewollt:
in Uniform und im Talare
der wildgewordne Teutobold.
Und wie dein Blut die Steine netzte,
da atmet auf das Militär.
Es kondoliert, wer grad noch hetzte …
Du warst der Erste nicht – bist nicht der Letzte.
Prost Helfferich!
Der kommt nicht mehr.
(Theobald Tiger (Kurt Tucholsky): Die Weltbühne, 8.9.1921, Nr. 36, S. 245.)
1912 hatte Kurt Tucholsky Erzberger bereits das Gedicht “Erzberger” gewidmet:
Erzberger
Du guter Mond aus Buttenhausen!
Du leuchtest durch den Wolkenflor.
Wenn auch die bösen Stürme brausen –
sanft strahlt dein mildes Rund empor.
Und ob der ganze Schnee verbrennt,
ob uns ein leiser Zephir fächelt –
wie immer auch das Firmament:
Matthias lächelt.
Was hattest du im Krieg zu schuften!
Du reistest in und aus der Schweiz.
Tät wo ein kleines Stänklein duften,
du, Lieber, wußtest es bereits.
Gewiß, du hast den Zimt erkannt,
hast Tirpitz wacker durchgehechelt . . .
Ein Trost blieb uns im Weltenbrand:
Matthias lächelt.
Was bist du alles schon gewesen!
Ein wilder Weltannexionist
(man kann es leider heut noch lesen),
dann, als es schief ging, Pazifist . . .
Man sah dich stets mit wem paktieren,
du machtest dich dem Reich bezahlt . . .
Wir wußten: Uns kann nichts passieren –
Matthias strahlt.
Du sanft Gestirn stehst nun am Himmel
und – leider Gottes! – im Zenit.
Gewiß, du bist in dem Gewimmel
der schlimmste nicht, den man da sieht.
Die Sterne in der hohen Halle,
die übler Kriegsgewinst geeint,
du überstrahlst sie alle, alle – –
Matthias grinst.
Und Deutschland weint.
————————————————————————-
Der Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne schrieb 1940 nochmals Geschichte. Am 22. Juni 1940 unterzeichnete die französische Delegation unter Philippe Pétain (1856–1951) den Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich im Wald von Compiègne – an genau derselben Stelle, an der 1918 Deutschland kapituliert hatte. Hitler hatte das bewusst so inszeniert, um eine Demütigung Frankreichs zu erreichen. Der gleiche Eisenbahnwaggon, in dem Foch 1918 den Waffenstillstand diktierte, wurde aus einem Museum herantransportiert. General Pétain war zu dieser Zeit in Vichy wo die neue Regierung bald ihren Sitz nahm. Er hatte am 17. Juni 1940 öffentlich erklärt einen Waffenstillstand anzustreben („Es gilt, die Kämpfe einzustellen“).
Hitlers Freudentanz in Compiègne
Für viele Franzosen wandelte sich die Verehrung der Ersten-Weltkriegs-Helden ins Umgekehrte. Der Sieger von Verdun (1916) wurde 1940 zum Kollaborateur. Er bewilligte die Einführung antisemitischer Gesetze, ohne direkten deutschen Zwang. Er unternahm auch nichts, um den Juden-Deportationen entgegenzuwirken. Zu dieser Zeit war der Mann 84 Jahre alt. Man kann sagen, Alter schützt vor Torheit nicht. Somit hat er die Vorstellung des Volkshelden von 1916 zerstört.
Nach der Befreiung Frankreichs 1944 wurde Pétain als Hochverräter angeklagt. 1945 verurteilte man ihn zum Tod. Doch General de Gaulle wandelte das Urteil in lebenslange Haft um – aus Respekt vor seinem Ruhm von 1916. Pétain starb 1951 in Gefangenschaft, einsam und entehrt.
Manchmal denke ich, man hätte den verborten Greis zum Sterben aus der Haft entlassen sollen. Die Franzosen denken darüber anders und haben sicher recht.
Charles de Gaulle vermied es in den 1960ern, Pétain pauschal zu „dämonisieren“ – wohl auch, um die nationale Versöhnung zu erleichtern. Dennoch bleibt Pétain bis heute eine rote Linie im politischen Diskurs: Wer ihn relativiert oder gar würdigt, löst in Frankreich heftige Skandale aus.
Beispiel: 2018 äußerte Präsident Macron, man dürfe Pétain „nicht aus der Geschichte löschen“, da er 1916 ein Held war. Das führte zu einem landesweiten Aufschrei.